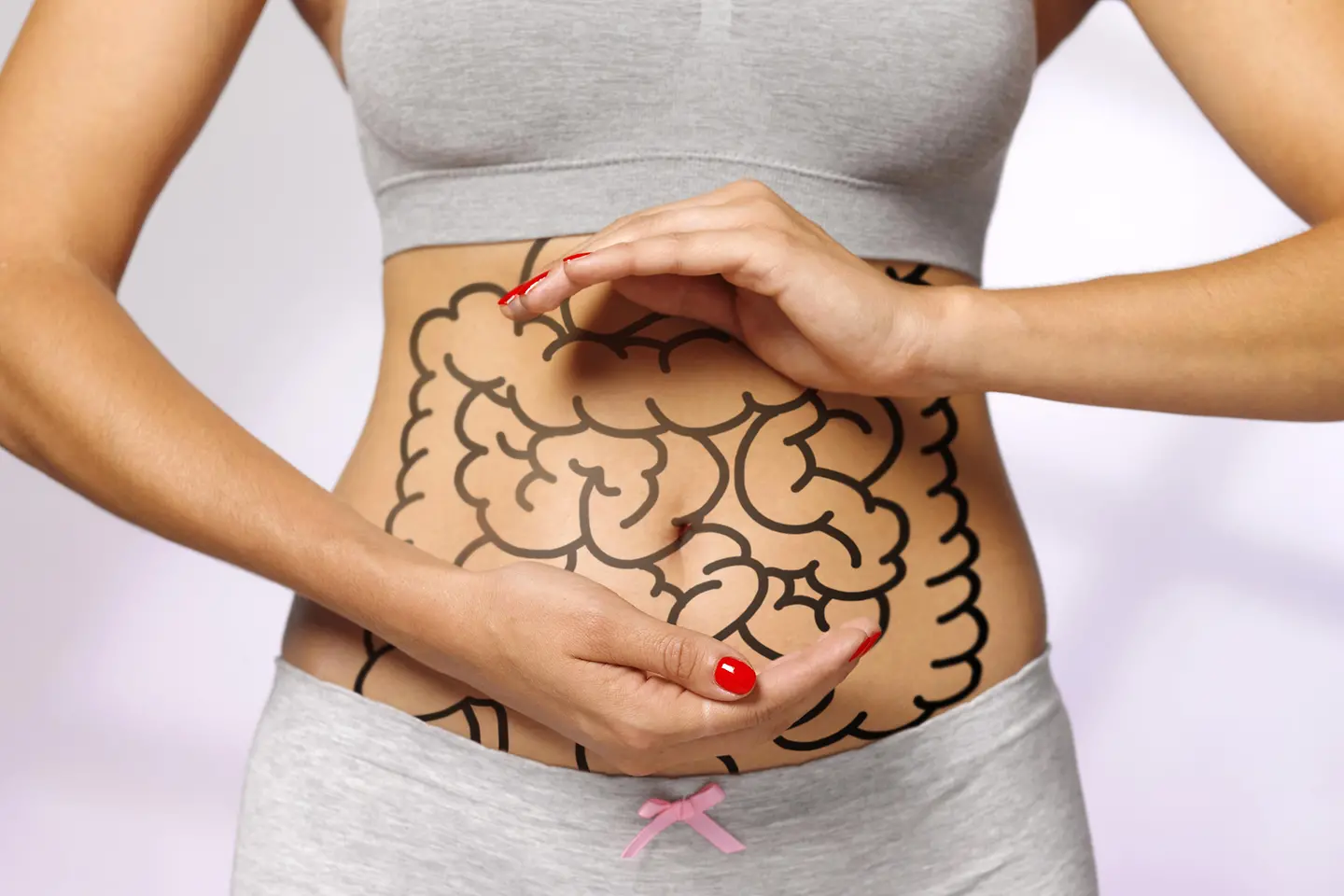- Auf einen Blick
- Was ist eine Divertikulitis?
- Welche Symptome treten bei einer Divertikulitis auf?
- Welche Ursachen und Risikofaktoren gibt es für Divertikulitis?
- Wie häufig sind Divertikel?
- Wie verläuft eine Divertikulitis?
- Wie wird die Diagnose Divertikulitis gestellt?
- Wie sieht die Therapie bei einer Divertikulitis aus?
- Welche Möglichkeiten zur Vorbeugung und Früherkennung von Divertikulitis gibt es?
- Was ist sonst noch wichtig?
Ein plötzlicher, dumpfer Schmerz im linken Unterbauch – erst leicht, dann hartnäckig, dazu leichtes Fieber, Blähungen, Verstopfung oder Durchfall. Was zunächst wie eine harmlose Magen-Darm-Infektion oder Verdauungsstörung erscheint, kann auf eine Divertikulitis hinweisen: eine Entzündung kleiner Ausstülpungen im Dickdarm, die plötzlich Beschwerden verursacht.
Auf einen Blick
- Symptome: Oft treten bei einer Divertikulitis Schmerzen im linken Unterbauch auf, begleitet von Blähungen, Stuhlunregelmäßigkeiten wie Verstopfung oder Durchfall und gelegentlichem Fieber. In schweren Fällen kann es zu Übelkeit, Erbrechen oder Blut im Stuhl kommen.
- Ursachen: Zu den wesentlichen Ursachen für die Divertikel zählt eine ballaststoffarme Ernährung, die zu verhärtetem Stuhl und erhöhtem Druck im Darm führt. Dies begünstigt die Bildung von Divertikeln, die sich entzünden können. Weitere Risikofaktoren sind Bewegungsmangel, Übergewicht, Rauchen und genetische Veranlagung.
- Verlauf: In zahlreichen Fällen verläuft die Erkrankung ohne Beschwerden. Kommt es zu einer akuten Entzündung, tritt diese häufig schubweise auf und kann Komplikationen wie Abszesse, Fisteln oder sogar eine Darmperforation nach sich ziehen.
- Diagnose: Die Diagnose stützt sich auf eine Kombination aus Arztgespräch, körperlicher Untersuchung und bildgebenden Verfahren wie Ultraschall oder Computertomografie, um Entzündungen der Divertikel und mögliche Komplikationen zuverlässig zu erkennen.
- Therapie: Bei milden Verläufen reichen eine Ernährungsumstellung und Antibiotika zur Behandlung aus. Treten Komplikationen auf, kann eine Operation notwendig sein.
ICD-10-Code für Divertikelkrankheit: K57
ICD-Codes benennen medizinische Diagnosen einheitlich und stehen auf elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAU). Diese finden Sie zum Beispiel im Online-Portal oder in der App Ihrer Krankenkasse.
Was ist eine Divertikulitis?
Eine Divertikulitis ist eine entzündliche Erkrankung des Dickdarms, die von sogenannten Divertikeln ausgeht. Dabei handelt es sich um kleine, sackartige Ausstülpungen der Darmwand, die vor allem im Bereich des sogenannten Colon sigmoideum entstehen – dem S-förmigen Abschnitt des Dickdarms kurz vor dem Mastdarm, der auf der linken Seite des Unterbauchs liegt.

Bei Frauen können Divertikulitis-Symptome leicht mit gynäkologischen Erkrankungen wie Zysten oder Endometriose verwechselt werden.
Die bloße Existenz von Divertikeln wird als Divertikulose bezeichnet. Dabei handelt es sich um eine in der Regel symptomfreie Vorstufe. Erst wenn sich Divertikel entzünden, liegt eine Divertikulitis vor.
Welche Symptome treten bei einer Divertikulitis auf?
Eine Divertikulitis äußert sich häufig durch plötzlich auftretende, dumpfe Schmerzen im linken Unterbauch. Begleitende Symptome einer Divertikulitis können Fieber, Verdauungsstörungen wie Verstopfung oder Durchfall, Blähungen und Übelkeit sein. Beschwerden wie häufiger Harndrang und Schmerzen beim Wasserlassen können ebenfalls vorkommen. Das ist der Fall, wenn die entzündeten Darmbereiche die Blase reizen.
Divertikulitis: Symptome bei Frauen
Bei Frauen können die Beschwerden einer Divertikulitis leicht mit anderen Krankheitsbildern verwechselt werden. Denn diese ähneln häufig den Symptomen gynäkologischer Erkrankungen wie Eierstockzysten, Endometriose oder Entzündungen im Beckenbereich. Auch Schmerzen beim Wasserlassen oder beim Geschlechtsverkehr können irreführend sein. Umso wichtiger ist es, dass unklare Unterbauchbeschwerden ärztlich untersucht werden.
Welche Ursachen und Risikofaktoren gibt es für Divertikulitis?
Eine Divertikulitis entsteht durch die Entzündung oder Infektion von Divertikeln – kleinen Ausstülpungen der Darmwand, die sich vor allem im Dickdarm bilden. Die genaue Ursache für die Entzündung ist noch nicht vollständig geklärt. Es wird jedoch angenommen, dass ein erhöhter Druck im Darm zur Bildung von Divertikeln beiträgt. Wenn sich Stuhlreste in diesen Ausstülpungen ansammeln, können diese die Schleimhaut reizen und eine Entzündung sowie Durchblutungsstörungen hervorrufen.
Risikofaktoren für eine Divertikulose sind:
- Ballaststoffarme Ernährung: Eine Ernährung mit wenig Ballaststoffen kann zu hartem Stuhl und Verstopfung führen, was den Druck im Darm erhöht und die Bildung von Divertikeln begünstigt.
- Alter: Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, Divertikel zu entwickeln, da die Elastizität der Darmwand nachlässt.
- Genetische Faktoren: Es gibt Hinweise darauf, dass eine familiäre Veranlagung das Risiko für Divertikulitis erhöhen kann.
Es ist wichtig zu beachten, dass nicht jede Person, die Divertikel hat, zwangsläufig eine Divertikulitis entwickelt. Die Entzündung tritt nur bei einem Teil der Betroffenen auf. Welche Faktoren das Risiko für eine Entzündung der Divertikel erhöhen, ist jedoch nicht vollständig geklärt.
Ihr Newsletter für ein gesünderes Leben
Jetzt unverbindlich anmelden und monatlich Gesundheitsthemen mit wertvollen Tipps erhalten und über exklusive Barmer-Services und -Neuigkeiten informiert werden.
Newsletter abonnieren
Wie häufig sind Divertikel?
Divertikel im Dickdarm, die sogenannte Divertikulose, sind in westlichen Industrieländern weit verbreitet – insbesondere bei Menschen im höheren Lebensalter. Schätzungen zufolge sind in etwa folgende Bevölkerungsanteile betroffen:
- 13 % der unter 50-Jährigen
- 30 % der 50- bis 70-Jährigen
- 50 % der 70- bis 85-Jährigen
- 66 % der über 85-Jährigen
Allerdings entwickelt nur ein kleiner Teil der Betroffenen eine Divertikulitis. Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe von zehn Jahren an einer solchen Entzündung zu erkranken, beträgt durchschnittlich 4,3 Prozent. Besonders auffällig: Das Risiko ist bei jüngeren Personen am höchsten – bei 40-Jährigen liegt es bei etwa 11 Prozent. Mit jedem weiteren Lebensjahrzehnt nimmt dieses Risiko ab, und zwar um 24 Prozent pro Dekade.
Wie verläuft eine Divertikulitis?
Der Verlauf der Erkrankung kann stark variieren und reicht von beschwerdefreien Phasen bis zu schweren Komplikationen. Fachleute unterscheiden dabei verschiedene Stadien der Divertikulitis, abhängig davon, ob die Entzündung unkompliziert oder mit Komplikationen verbunden verläuft.
In etwa 75 Prozent der Fälle bleibt die Divertikulitis lokal begrenzt und verläuft ohne schwerwiegende Folgeerscheinungen. Diese unkomplizierten Verläufe lassen sich in der Regel konservativ, das heißt ohne operativen Eingriff, behandeln und heilen vollständig aus.
In rund einem Viertel der Fälle entwickelt sich eine komplizierte Divertikulitis. Hierbei kann es zu Abszessen, Fisteln, Darmdurchbrüchen (Perforation) oder einer Bauchfellentzündung (Peritonitis) kommen. Diese schwereren Verläufe erfordern meist eine engmaschige Überwachung und gegebenenfalls einen chirurgischen Eingriff.
Manche Betroffene haben wiederholt Schübe einer Divertikulitis. Diese chronisch verlaufende Form kann zu dauerhaften Veränderungen im Darm führen und ebenfalls eine operative Behandlung erforderlich machen, wenn Beschwerden anhalten oder Komplikationen drohen.
Wie wird die Diagnose Divertikulitis gestellt?
Bei Verdacht auf eine Divertikulitis ist die genaue ärztliche Untersuchung entscheidend, um andere Ursachen für Bauchschmerzen auszuschließen und den Schweregrad der Erkrankung einzuschätzen.
Zunächst erfolgt ein ausführliches Gespräch über die Beschwerden (Anamnese). Die betroffene Person wird nach ihren Schmerzen, dem Stuhlverhalten sowie Begleiterkrankungen und möglicherweise eingenommenen Medikamenten befragt. Anschließend erfolgt eine körperliche Untersuchung. Dabei wird besonders auf Druckschmerzen im linken Unterbauch geachtet, denn diese sind ein typisches Zeichen der Erkrankung. Zudem wird gemessen, ob eine erhöhte Temperatur oder Fieber besteht. Ultraschalluntersuchungen können ebenfalls Hinweise auf eine Divertikulitis geben. Diese sind vor allem in unkomplizierten Fällen hilfreich.
Im nächsten Schritt kommen weitere bildgebende Verfahren zum Einsatz. Die wichtigste Methode zur Diagnostik ist die Computertomographie (CT) des Bauches mit Kontrastmittel. Sie kann Entzündungen, Abszesse oder andere Komplikationen zuverlässig sichtbar machen und hilft, zwischen unkomplizierter und komplizierter Divertikulitis zu unterscheiden.
Auch eine Blutuntersuchung kann Hinweise auf eine Divertikulitis liefern. Liegt eine Divertikulitis vor, können bestimmte Blutzellen oder Entzündungsmarker erhöht sein.
In manchen Fällen – etwa bei jungen Patientinnen und Patienten oder bei häufigen Schüben – kann ergänzend eine Darmspiegelung (Koloskopie) sinnvoll sein. Diese wird jedoch nicht während einer akuten Entzündung durchgeführt, sondern erst im Anschluss, wenn der Darm sich beruhigt hat. Sie dient dazu, andere Erkrankungen wie Darmkrebs oder chronisch-entzündliche Darmerkrankungen auszuschließen.
Mit der Barmer Arztsuche eine gastroenterologische Praxis in Ihrer Nähe finden
Finden Sie Medizinerinnen und Mediziner nach Fachgebiet und Therapieschwerpunkt sortiert in Ihrer Umgebung und deutschlandweit.
Barmer Arztsuche
Wie sieht die Therapie bei einer Divertikulitis aus?
Die Behandlung der Divertikulitis richtet sich danach, ob es sich um eine unkomplizierte oder komplizierte Erkrankung handelt – also ob beispielsweise Abszesse oder andere Komplikationen vorliegen.
Behandlung einer unkomplizierten Divertikulitis
In den meisten Fällen verläuft die Erkrankung unkompliziert. Dann genügt oft eine konservative Behandlung, das heißt ohne Operation. Früher wurde standardmäßig ein Antibiotikum verabreicht. Heute ist dies nicht mehr in jedem Fall notwendig. Entscheidend sind der Allgemeinzustand der betroffenen Person und die Schwere der Entzündung.
Wichtig sind in dieser Phase:
- Schonung und gegebenenfalls ein vorübergehender Verzicht auf feste Nahrung
- Flüssigkeitszufuhr, beispielsweise über klare Brühen oder Tees
- Schmerzmedikamente nach ärztlicher Verordnung
Ein Krankenhausaufenthalt ist nur erforderlich, wenn die Beschwerden stark sind, das Allgemeinbefinden eingeschränkt ist oder Vorerkrankungen bestehen.
Behandlung einer komplizierten Divertikulitis
Bei Komplikationen – etwa, wenn sich ein Abszess bildet, eine Fistel entsteht oder es zu einem Darmdurchbruch kommt – ist eine stationäre Behandlung nötig. Dann erfolgt in der Regel:
- Gabe von Antibiotika
- Überwachung durch bildgebende Verfahren
- Kontrolle durch Laboruntersuchungen
- Gegebenenfalls ein kleiner chirurgischer Eingriff, etwa eine Drainage bei einem Abszess
In schweren oder wiederkehrenden Fällen kann eine größere Operation notwendig sein. Dabei wird der betroffene Darmabschnitt entfernt. Dies geschieht oft minimalinvasiv, also mit kleinen Schnitten und Kameraunterstützung.

Bei Divertikulitis hilft eine ballaststoffreiche, fleischreduzierte Ernährung, den Heilungsverlauf zu unterstützen und Rückfällen vorzubeugen.
Ernährung: Was darf man bei Divertikulitis (nicht) essen?
Während einer akuten, unkomplizierten Divertikulitis kann es hilfreich sein, den Darm zu entlasten. In der Anfangsphase ist flüssige oder leichte Kost ideal – etwa klare Brühe, Tee oder Wasser, je nach Verträglichkeit auch Breie oder pürierte Suppen. Sobald die Beschwerden nachlassen, kann schrittweise wieder auf eine ballaststoffreiche Ernährung umgestellt werden. Diese trägt dazu bei, den Stuhl weicher zu machen und den Darm zu entlasten. Empfohlen werden dabei vor allem Vollkornprodukte, Gemüse, Hülsenfrüchte und immer auch ausreichend Flüssigkeit.
Auf schwer verdauliche, blähende und sehr fettreiche Speisen sollte zunächst verzichtet werden. Eine angepasste Ernährung unterstützt nicht nur den Heilungsverlauf, sondern kann auch Rückfällen vorbeugen. Aus ernährungsmedizinischer Sicht sind vor allem folgende Aspekte wichtig:
- Ballaststoffreiche Kost: Täglich sollten mindestens 30 Gramm Ballaststoffe verzehrt werden – idealerweise aus Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkorngetreide, Nüssen und Samen. Im Gegensatz zu früheren Empfehlungen gilt heute als gesichert: Nüsse, Samen oder ganze Körner sind unbedenklich und fördern sogar eine gesunde Verdauung.
- Wenig Fleisch oder vegetarisch: Besonders empfehlenswert ist eine vegetarische Ernährung oder ein reduzierter Fleischkonsum – insbesondere bei rotem Fleisch wie Rind, Schweine und Lamm.
- Gesundes Körpergewicht: Auch das Körpergewicht spielt eine Rolle. Wer starkes Übergewicht vermeidet, kann zusätzlich das Risiko für Komplikationen senken.
Nutzen Sie bis zu 200 Euro für Gesundheitskurse pro Jahr
Egal ob Bewegung, gesunde Ernährung oder Stressbewältigung: Finden Sie mit nur wenigen Klicks den für Sie passenden Gesundheitskurs – online oder vor Ort.
Jetzt Gesundheitskurse finden
Welche Möglichkeiten zur Vorbeugung und Früherkennung von Divertikulitis gibt es?
Eine spezielle Früherkennungsuntersuchung für Divertikulitis gibt es nicht. Divertikel, also Ausstülpungen der Darmschleimhaut, entstehen häufig im höheren Lebensalter und bleiben oft lange unbemerkt. Meist werden sie zufällig im Rahmen einer Darmspiegelung entdeckt, zum Beispiel bei der Darmkrebsvorsorge.
Zur Vorbeugung einer Divertikulitis ist ein gesunder Lebensstil empfehlenswert. Dazu zählt vor allem eine ballaststoffreiche Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukten, ausreichend Flüssigkeit sowie regelmäßige körperliche Bewegung. Diese Maßnahmen fördern eine geregelte Verdauung und beugen Verstopfung vor – einem wichtigen Risikofaktor für die Entstehung von Divertikeln und deren Entzündung. Auch der Verzicht auf rotes Fleisch, Alkohol und Rauchen kann das Risiko für die Entstehung von Divertikeln und Komplikationen reduzieren.
Bei Menschen mit wiederkehrenden Entzündungen oder chronischen Beschwerden wird individuell geprüft, ob eine weiterführende Behandlung oder Kontrolle sinnvoll ist. Eine pauschale Empfehlung zur medikamentösen Langzeitprophylaxe oder operativen Entfernung ohne Beschwerden gibt es nicht – solche Entscheidungen hängen immer vom Einzelfall ab.
Was ist sonst noch wichtig?
Nicht jede Divertikelerkrankung verläuft mit Entzündungen. Eine Divertikelblutung ist eine weitere mögliche Komplikation. Dabei kann es zu sichtbaren Blutabgängen über den After kommen, die schmerzlos, aber sehr beunruhigend sein können. Diese Blutungen entstehen, wenn in der Nähe eines Divertikels ein kleines Gefäß verletzt wird. Meist hören sie von selbst wieder auf, sollten aber ärztlich untersucht werden.