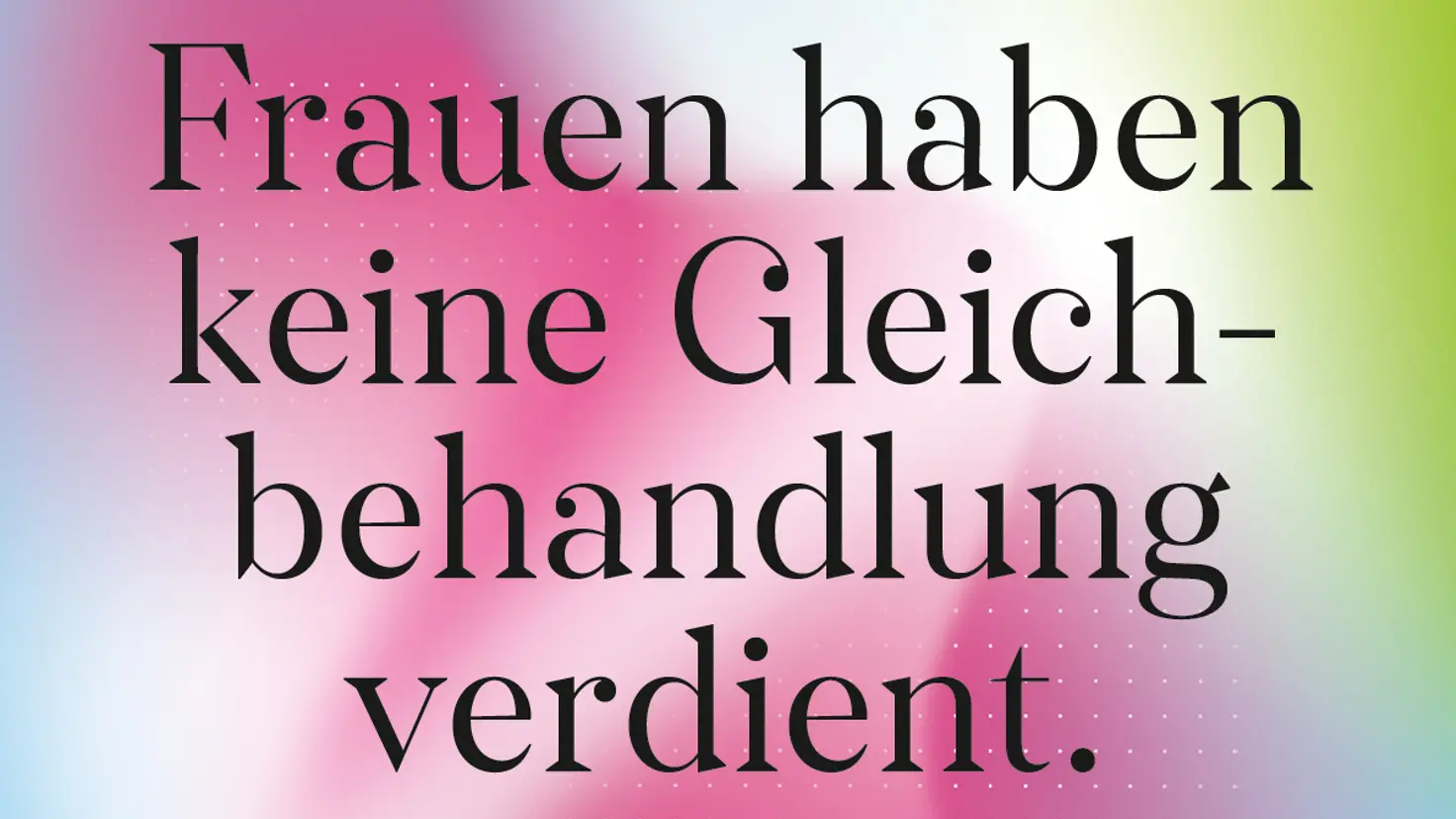Die Anästhesistin Dr. Ursula Marschall ist Forschungsbereichsleiterin des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung. Die langjährige Notärztin, Schmerztherapeutin und Intensivmedizinerin setzt sich für eine medizinische Versorgung ein, welche die biologischen, psychischen und sozialen Unterschiede zwischen Männern und Frauen viel stärker berücksichtigt und in diesem Sinne Mut zeigt zu einer #Ungleichbehandlung. Damit beide Geschlechter eine bessere Medizin erhalten.
Frau Dr. Marschall, wo kann man nachschauen, wie der Anteil von Frauen und Männern unter den etwa neun Millionen Versicherten der Barmer ist?
Marschall: Zum Beispiel in unserem Geschäftsbericht. Wir Versorgungsforscher sehen es in unser täglichen Arbeit, wenn wir mit den uns vorliegenden Daten arbeiten. Wir haben die Geschlechterverteilung also ständig im Blick.
Und wie ist der Anteil konkret?
Marschall: Das Verhältnis liegt bei etwa 60:40 zugunsten der Frauen. Historisch gesehen sind wir als ehemalige Angestelltenkrankenkasse eine eher weiblich geprägte Krankenkasse. Es gibt wiederum andere Krankenkassen, da dominieren die Männer.
Hat dieser Genderaspekt Auswirkungen auf die gesundheitlichen Fragestellungen und Forschungsprojekte Ihres Instituts?
Marschall: In gewisser Weise schon. Wir wenden komplexe statistische Verfahren an und können in vielen Fällen ein bevölkerungsrepräsentatives Bild zeichnen. Als bundesweite Kasse, die etwa 13 Prozent aller Menschen in der gesetzlichen Krankenversicherung versorgt, können wir in der Regel mit unseren Publikationen sehr gute Aussagen für Deutschland treffen.
Besteht aber nicht doch die Gefahr, Daten wegen dieser Verteilung der Geschlechter falsch zu interpretieren?
Marschall: Weil wir unsere Versichertenstruktur kennen, sehe ich diese Gefahr in unserem täglichen Handeln nicht. Aber wir arbeiten auch mit externen Wissenschaftlern zusammen, die auf unsere Daten zurückgreifen. Und immer wieder bemerken wir, dass diese Kolleginnen und Kollegen erst einmal doch verblüfft darüber sind, welche Krankheiten ihnen in welcher Häufung und Verteilung da begegnen. Daher klären wir diese Kolleginnen und Kollegen über die Besonderheiten unseres Versichertenkollektivs auf.
Was wissen wir aus Daten einer Krankenkasse eigentlich darüber, wie gesund oder krank Versicherte sind?
Marschall: Krankenkassendaten sind Abrechnungsdaten. Wir sehen also Leistungen, die mit uns abgerechnet werden. Unsere Daten sind insofern keine medizinischen Daten. Gleichwohl sehe ich in ihnen einen absoluten Schatz für die Forschung, weil wir Behandlungsanlässe und auch Behandlungsepisoden nachverfolgen können: beispielsweise dann, wenn eine Patientin oder ein Patient vom niedergelassenen Arzt eine Überweisung ins Krankenhaus erhält und später wieder in der Arztpraxis einen Termin hat. Wir haben Informationen über die Medikation oder ob ein Versicherter einen Rollator erhält und welche Erkrankung in der Abrechnung vermerkt ist. Aber wir bekommen zum Beispiel keine Laborwerte und auch keine Informationen zu Tumorstadien. Um aus diesen Daten sinnvolle Schlüsse ziehen zu können, gehen wir interdisziplinär in Teams an Fragestellungen heran. Einzelkämpfer würden zu falschen Schlussfolgerungen gelangen. Wichtig ist, dass wir hier keine Versorgungsforschung im Elfenbeinturm machen. Die Ergebnisse unserer Analysen sollen sich in einer verändernden Versorgung wiederfinden. Ein Beispiel ist der aktuelle Arzneimittelreport.
Was macht Ihr Institut mit diesen Daten?
Marschall: Entscheidend ist die Frage: Was wollen wir in Erfahrung bringen? Dann schauen wir, ob wir diese Frage in den Daten überhaupt sehen können. Ein Beispiel ist die Medikamenteneinnahme bei Schwangeren. Wir können die Medikation einer Schwangeren nachvollziehen und wann sie entbunden hat. So weit, so gut. Aber das Kind selbst könnte ja in der Krankenkasse des Vaters oder privat versichert sein und nicht bei uns. Außerdem gibt es viele Fragen, die sich nicht in den Daten ablesen lassen, zum Beispiel, ob eine Schwangere die Medikamente selbstständig oder auf Anraten des behandelnden Arztes abgesetzt hat. Daher kombinieren wir Datenanalysen mit Befragungen und komplettieren das Bild auf diese Weise. Ein anderes Beispiel sind Kreidezähne: Unsere Daten zeigen einen Zusammenhang zwischen einer Antibiotikaverordnung in den ersten Lebensjahren eines Kindes und der Wahrscheinlichkeit zur Ausbildung von Kreidezähnen. Die einzelne Zahnärztin oder ihr Kollege kann Zusammenhänge wie diese natürlich in der eigenen Praxis oft nicht unmittelbar herstellen.
Unsere Analysen sind dann häufig Grundlagen für vertiefende Informationen und Services, zum Beispiel für Schwangere. Ein weiteres Ergebnis unserer Forschung mit den vorliegenden Daten sind besondere Versorgungsverträge, zum Beispiel das Kardio-MRT.
Apropos Forschung und Lehre: Die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten ist in Deutschland in derzeit 39 Medizinischen Fakultäten organisiert. Wie viele Lehrstühle für Gendermedizin gibt es an den Unis?
Marschall: Es gibt vereinzelte, wahrscheinlich weniger als eine Handvoll.
Wie viele halten Sie für nötig? Oder ist es der falsche Ansatz, Gender an den Universitäten in professoralen Leuchttürmen zu organisieren?
Marschall: Nur mehr Lehrstühle zu fordern um die Gendermedizin voranzutreiben, ist nicht der Weg. Wir benötigen in allen Bereichen mehr Sensibilität für das Thema. Lehrstühle können aber in der Tat für die Organisation, die Bündelung und Koordination von Forschung nützlich sein. Gendermedizin muss auf alle Fälle in den Versorgungsalltag integriert werden. Und wo universitäre Versorgung stattfindet, gibt es auch Forschung. Noch einmal: Die Verbreitung des Gender-Gedankens findet nicht allein durch Leuchtturm-Lehrstühle statt.
…und weil inzwischen die große Mehrheit aller Studierenden der Medizin weiblich sind, wird das Gender in der Medizin heute automatisch mitgedacht?
Marschall: Teils. Als ich Medizin studiert habe, da waren wir in der Klinikgruppe acht Männer und zwei Frauen. Heute ist es umgekehrt. Früher gab es praktisch keine weiblichen Oberärzte oder gar Chefärztinnen. Teilzeit- und Kliniktätigkeit hat sich quasi ausgeschlossen. Die Realität ist heute zum Glück dann doch eine andere: Wir haben in den großen Kliniken inzwischen Kinderbetreuung, die sich sogar nach den Arbeitszeiten von Ärztinnen richtet. Gendermedizin ist nicht gleich Frauenmedizin. Aber ich brauche neben der historisch männlich orientierten Medizin auch eine Medizin, die die Frauen viel stärker als bislang in den Blick nimmt. Und darüber hinaus gilt es, konsequent die Bedürfnisse des einzelnen Patienten als Richtschnur für das eigene therapeutische Handeln zu nehmen.
Wie geschlechtssensibel sind Studien zu Arzneimitteln und zu medizinischen Verfahren und Technologien (Health Technology Assessments, HTAs) heute?
Marschall: Bei den Arzneimittelstudien sind wir inzwischen deutlich weiter, was die Berücksichtigung der Unterschiede von Frauen und Männern betrifft. Allerdings gibt es weiterhin grundsätzliche Einschränkungen, was die Auswahl von Studienteilnehmenden betrifft: So scheidet jede Frau, die orale Kontrazeptiva einnimmt, also die "Pille", als Probandin aus. Solange die Verhütung aber Sache der Frauen ist, wird sich an dieser Stelle auch nicht viel verändern können. Ältere Menschen sind in der Regel kränkere Menschen, die auch Medikamente nehmen und daher ebenso nicht in Studien vor allem der Phase I eingeschlossen werden. Hier würde sich in einer Studie schon die Frage stellen, ob es das Medikament ist, das wirkt, oder ob nicht eine zugrundeliegende Erkrankung wie Adipositas, eine Nierenerkrankung oder eine Arthrose voranschreitet oder anderweitig Wirkungen entfaltet?
In der Arzneimittelforschung unterscheiden wir verschiedene Studienphasen. Gerade in der fortgeschrittenen Entwicklungsphase und vor allem nach der Zulassung benötigen wir Studiendaten aus der Versorgungsrealität. Hier müssen neben der Genderthematik vor allem auch die verschiedenen Altersgruppen stärker berücksichtigt werden, vor allem die älteren Patienten. Während die Nutzenbewertung bei den Arzneimitteln fest geregelt ist, sehe ich bei den medizinischen Verfahren und Technologien aber noch einen viel drängenderen Handlungsbedarf.
Wo sehen Sie bei Arzneimittelstudien weitere große Veränderungen?
Marschall: Wir beobachten seit einigen Jahren quasi eine Revolution durch die Immuntherapie bei der Behandlung von Menschen mit Krebs. Immuntherapeutika werden nicht für einzelne Erkrankungen entwickelt, sondern für bestimmte Treibermutationen der Krebszelle. Tumorzellen sind körpereigene Zellen, deren Wachstum außer Kontrolle geraten ist. Das Wachstum wird durch die Treibermutationen angetrieben. Daher haben Immuntherapeutika das Zeug zum Game Changer, das können wir beim Lungenkrebs oder dem schwarzen Hautkrebs sehr gut beobachten.
Arzneimittelstudien allein können die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wirkweise eines Medikamentes nicht abschließend beschreiben, daher fordert der Gesetzgeber die laufende und systematische Überwachung von Fertigarzneimitteln und von Impfstoffen ein. Wie sieht es auf diesem Gebiet aus, auch mit Blick auf Geschlechtsunterschiede?
Marschall: Wenn ein Medikament einmal zugelassen ist, dann gibt es leider kaum eine strukturierte weitere Erforschung. Problematisch ist zudem, dass die Probanden aus den Studien aus den genannten Gründen später nicht übereinstimmen mit den Patienten, die die Medikamente nach deren Zulassung einnehmen, denn wir haben ja gesagt, dass Kinder, ältere, multimorbide Menschen oder Frauen im gebärfähigen Alter, die die Pille nehmen, für Studien nicht in Frage kommen.
Wie sieht es mit dem Gendern bei den medizinischen Leitlinien aus, insbesondere bei denen mit dem höchsten Grad an Evidenz?
Marschall: Medizinische Leitlinien repräsentieren den aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft. Aber Gender erst bei den Leitlinien anzufangen, das ist zu spät gedacht. Wir brauchen also Gender in der Ausbildung der Ärztinnen und Ärzte von morgen und der klinischen Versorgung, die wiederum die Forschung antreibt. Wenn hieraus Erkenntnisse resultieren, können sie später in Leitlinien einfließen. Wir sollten das Pferd aber nicht von hinten aufzäumen.
Frauen werden hierzulande durchschnittlich etwa fünf Jahre älter als Männer. Welche Gründe werden angenommen, welche lassen sich mit einer gewissen Plausibilität oder gar Evidenz anführen und wo tut man dem „starken“ Geschlecht am Ende des Tages auch Unrecht?
Marschall: Die Gründe sind vielfältig. Das beginnt schon mit dem Geschlechtsbild und geht weiter bei der Erziehung mit dem Satz: Indianer kennen keinen Schmerz. Männer leben diese Rolle dann auch und hatten und haben ein ausgeprägteres Risikoprofil, zum Beispiel im Straßenverkehr oder beim Konsum von Tabak und weiteren Drogen. Frauen wiederum haben andere hormonelle Grundvoraussetzungen, der für viele Jahre zum Beispiel zu einem besseren Schutz vor Herzinfarkt. beiträgt. Inzwischen wissen wir auch immer mehr über die Funktion der Geschlechtshormone und deren vielfältige Wirkung im Körper. Neue Erkenntnisse zeigen, dass die Östrogene nicht nur beim Brust- sondern auch beim Lungenkrebs eine wichtige Rolle spielen.
Unterschiede zeigen sich nicht nur zwischen den Geschlechtern, auch Alter und physiognomische Eigenschaften oder Besonderheiten unter Frauen können das Wirken von Pharmaka beeinflussen. Wie ließe sich im Gesundheitswesen die Aufmerksamkeit für diese Unterschiede innerhalb der Geschlechter schärfen?
Marschall: Die Arzneimittelforschung beschäftigt sich nicht nur mit der Wirkung und Nebenwirkung von Medikamenten, sondern auch mit den physiologischen Vorgängen im Körper. Konkret mit der Frage: Wo und wie wird das Medikament wieder abgebaut? Dies geschieht sehr häufig in der Leber oder auch in der Niere. Mit voranschreitendem Alter nimmt diese Entgiftungsfunktion der Organe ab, das beginnt schon ab einem Alter von 30 Jahren. Wenn ich also ein spezielles Antibiotikum – ein sogenanntes Aminoglykosid – verordne, muss ich wissen, wie es um die Nierenfunktion meiner Patientin oder meines Patienten bestellt ist. Ist diese wegen des Alters oder einer Vorerkrankung eingeschränkt, muss ich die Dosierung vermindern, sonst droht eine Hörschädigung. Ähnliche Verbindungen gibt es auch bei Schmerzmitteln.
Wir wissen, dass Hausärztinnen und Hausärzte regelmäßig circa 100 verschiedene Arzneimittelwirkstoffe verordnen. Eine elektronische Unterstützung ist hier sicherlich hilfreich, um die Risiken frühzeitig zu identifizieren. Wir begleiten hier als Barmer dazu verschiedene wissenschaftliche Projekte, die dieses in der realen Versorgung testen.
Wenn wir nun auf das blicken, was wir wissen und auch auf das, wo wir noch zweifeln oder vermuten: Können wir nichtsdestotrotz festhalten, dass wir mehr auf die unterschiedlichen Lebensphasen und -umstände von Menschen schauen sollten und dass sich präventive, kurative oder pflegerische Versorgungsangebote daran orientieren sollten?
Marschall: Ärztliches Handeln war schon immer auf den einzelnen Patienten ausgerichtet und damit individualisiert. Wir können die Behandlung heute aber sicher viel stärker personalisieren, die Onkologie zeigt das aktuell sehr deutlich. Die Medizin der Zukunft liegt in der Personalisierung. Darüber hinaus gilt ohnedies: Der Mensch ist mehr als die Summe seiner Organe. Wir haben die sozialen Komponenten und der Mensch hat eine Seele. Hier liegen große Potenziale für eine patientenorientierte, biopsychosoziale Versorgung von morgen.
Was können Patientinnen und Patienten selbst bewirken, damit die Versorgung geschlechtersensibel ist und die Lebensumstände einbezieht?
Marschall: Der Patient hat heute eine deutlich größere Rolle als früher. Den "Gott in Weiß" gibt es nicht mehr. Das bedeutet aber auch, dass dem Patienten eine höhere Eigenverantwortung zukommt als dies früher der Fall war und der Patient im eigenen Interesse aufgerufen ist, sich zu informieren, sich mit der eigenen Erkrankung oder belastenden Situation zu beschäftigen oder den Lebensstil anzupassen, wenn es notwendig ist. Es reicht eben nicht, den schmerzenden Rücken zur ,Reparatur‘ auf den OP-Tisch zu legen und Heilung zu erwarten. Für Rückenschmerzen gibt es neben den eindeutig organischen Veränderungen viele weitere Gründe:
• Übergewicht
• zu wenig Bewegung, schwache Rumpfmuskulatur
• zu schwere oder einseitige Belastung
• Muskelverspannungen (auch infolge einer Fehlbelastung)
• psychische Belastungen wie Stress am Arbeitsplatz, finanzielle oder familiäre Sorgen, Selbstzweifel, Erkrankungen wie eine Depression
• familiäre Veranlagung
Welche Anzeichen können Patientinnen und Patienten gute Hinweise darauf geben, dass ihnen jemand gegenübersitzt, der nicht nach dem Motto „Eine-Größe-für-alle-Patienten“ praktiziert?
Marschall: Ich würde jedem Patienten lieber ein einfaches Motto ans Herz legen: Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Wir haben in Deutschland die freie Arztwahl. Wenn die "Chemie" nicht stimmt, wenn ich mich nicht wohlfühle, dann habe ich die Option, den Arzt oder die Ärztin zu wechseln. Ob die Chemie stimmt, hat in aller Regel nichts mit dem Alter oder dem Geschlecht des Behandlers zu tun. Und über allem stünde für mich die Frage: Was will ich eigentlich erreichen, wenn ich mich an einen Arzt oder ein Krankenhaus wende?